Foto: David Baltzer
Das Pommes-Paradies
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadtim Rahmen der weltweiten Initiative 10children.orgab 10 JahrenUraufführung am 13. April 2024Münsterstraße 446, BühneJunges Schauspiel
Termine
Mi, 15.05. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Do, 16.05. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Fr, 17.05. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
So, 19.05. / 16:00 – 18:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Do, 13.06. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Ausverkauft! Evtl. Restkarten an der Abendkasse
Fr, 14.06. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Ausverkauft! Evtl. Restkarten an der Abendkasse
Sa, 15.06. / 18:00 – 20:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Mo, 24.06. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Di, 25.06. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Do, 27.06. / 10:00 – 12:00
Junges Schauspiel
Schauspiel und Spoken Word über Kinderarmut in einer reichen Stadt von Akın Emanuel Şipal Regie: Liesbeth Coltof
Münsterstraße 446, Bühne
Wir veröffentlichen regelmäßig neue Termine.
Über das Stück
Das Pommes-Paradies liegt in Belgien, sagt Johanna, die nachts im Supermarkt auf Emin trifft, der sich gerade die Taschen vollstopft. Moment, nachts im Supermarkt?
Ein Alltagsrhythmus aus dem Piepen des Warenscanners, Husten und Räuspern versetzt Kassiererin und Kund:innen in Trance. Bis der Junge und seine Mutter an der Reihe sind. Sie zählt Münzen ab, doch es reicht einfach nicht. Die Frau wird beschimpft, sie solle nicht alle aufhalten. Wütend beschließt Emin, sich nachts einschließen zu lassen.
Nun staunt er nicht schlecht, als er das nächtliche Eigenleben des Supermarkts entdeckt. Da sind die Nachtkassiererin, die statt Geld gute Geschichten verlangt, und der hektische Supermarktmanager, der den neuesten Energydrink »Sugar 3000« auf den Markt bringen will. Und der Brokkoli streitet mit den Chips darum, wer bei den Menschen beliebter ist. Die Motte isst derweil, was ihr gefällt. Denn was ist ein »Produkt«, und was heißt »gehören«? Wer Hunger hat, nimmt von dem, was da ist, oder?
Die renommierte Regisseurin Liesbeth Coltof, in Düsseldorf durch »Der Junge mit dem Koffer« und »Antigone« bekannt, hat das weltweite Projekt 10children.org initiiert, zu dem auch »Das Pommes-Paradies« gehört. Auf allen Kontinenten wird künstlerisch zu Kinderarmut geforscht. Es entstehen ein Theaterstück, ein Dokumentarfilm, ein künstlerisches und ein pädagogisches Projekt. In Düsseldorf steht dabei das Essen im Mittelpunkt. Wie hängt Lebensmittelüberfluss mit Hunger, Armut mit Mangelernährung zusammen? Und was ist »stiller Hunger«? Das Thema wird das Junge Schauspiel über einen längeren Zeitraum begleiten. Auftakt ist nach dem Bürger:innendinner im März die Uraufführung von »Das Pommes-Paradies«.
Ein Alltagsrhythmus aus dem Piepen des Warenscanners, Husten und Räuspern versetzt Kassiererin und Kund:innen in Trance. Bis der Junge und seine Mutter an der Reihe sind. Sie zählt Münzen ab, doch es reicht einfach nicht. Die Frau wird beschimpft, sie solle nicht alle aufhalten. Wütend beschließt Emin, sich nachts einschließen zu lassen.
Nun staunt er nicht schlecht, als er das nächtliche Eigenleben des Supermarkts entdeckt. Da sind die Nachtkassiererin, die statt Geld gute Geschichten verlangt, und der hektische Supermarktmanager, der den neuesten Energydrink »Sugar 3000« auf den Markt bringen will. Und der Brokkoli streitet mit den Chips darum, wer bei den Menschen beliebter ist. Die Motte isst derweil, was ihr gefällt. Denn was ist ein »Produkt«, und was heißt »gehören«? Wer Hunger hat, nimmt von dem, was da ist, oder?
Die renommierte Regisseurin Liesbeth Coltof, in Düsseldorf durch »Der Junge mit dem Koffer« und »Antigone« bekannt, hat das weltweite Projekt 10children.org initiiert, zu dem auch »Das Pommes-Paradies« gehört. Auf allen Kontinenten wird künstlerisch zu Kinderarmut geforscht. Es entstehen ein Theaterstück, ein Dokumentarfilm, ein künstlerisches und ein pädagogisches Projekt. In Düsseldorf steht dabei das Essen im Mittelpunkt. Wie hängt Lebensmittelüberfluss mit Hunger, Armut mit Mangelernährung zusammen? Und was ist »stiller Hunger«? Das Thema wird das Junge Schauspiel über einen längeren Zeitraum begleiten. Auftakt ist nach dem Bürger:innendinner im März die Uraufführung von »Das Pommes-Paradies«.
Besetzung
Emin Cem Bingöl
Emins Mutter / Nachtkassiererin / Chips Aylin Celik
Johanna, genannt Joe / Kundin Yulia Yáñez Schmidt
Kassiererin / Motte / Ober-Chips / DHL-Zombie / Schulpsychologe / Chef Jonathan Gyles
Supermarktmanager / Johannas Vater / Kunde / Chips Eduard Lind
Brokkoli / Kunde / Lehrer / Alter Herr / Parasorgus Leon Schamlott
Obst / Gemüse / Lebensmittel Ensemble
Regie Liesbeth Coltof
Bühne Guus van Geffen
Kostüm Martina Lebert
Musik Matts Johan Leenders
Songwriting Aylin Celik
Dramaturgie Kirstin Hess
Theaterpädagogik Lena Hilberger
Dauer
2 Stunden — eine Pause
Förderung und Kooperation
Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. In Kooperation mit dem Amt für Soziales und Jugend der Landeshauptstadt Düsseldorf. 10children.org wurde initiiert durch Liesbeth Coltof und Dennis Meyer.
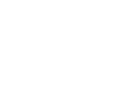


Pressestimmen