Foto: Thomas Rabsch
Homeoffice
Aus dem Japanischen von Andreas Regelsbergerauf Deutsch mit japanischen und englischen ÜbertitelnUraufführung am 20. April 2024Schauspielhaus, Großes HausSchauspiel
Über das Stück
Es gibt kaum etwas, das unseren Arbeitsalltag so sehr verändert hat wie das Homeoffice. Arbeitnehmer:innen sind dort tätig, wo es ihnen gefällt, sie pendeln nicht mehr zwischen der eigenen Wohnung und einem Unternehmenssitz, sondern arbeiten »on the road«, von Lissabon oder Thailand aus. Unternehmen sparen Geld für Büroraum, die Work-Life-Balance wird endlich erreicht. Sollte man meinen. In den USA allerdings hat gleichzeitig die Benutzung von Golfplätzen an Werktagen um 50 Prozent zugenommen …
Was also ist es im Kern, dieses sagenumwobene Homeoffice? Und was macht es mit uns?
Dem japanischen Theaterstar Toshiki Okada gelingt es immer wieder, explosive Situationen auf das Unterhaltsamste und Anregendste implodieren zu lassen. Okada ist bekannt für seine eigenwillige Formsprache und die Beschäftigung mit kulturellen Umbrüchen. Zusammen mit seiner Kompanie Chelfitsch erlangte er internationale Bekanntheit und ist mit seinen Inszenierungen in Asien und Nordamerika wie auch regelmäßig in Europa zu Gast, zuletzt in München und Hamburg.
Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Ensemble wird Toshiki Okada über unsere Gegenwart nachdenken – in faszinierenden Choreografien, die sich vollständig von ihrem Sprechen ablösen. Das Innerste wird zum Äußersten, rätselhafte Rituale entstehen.
Was also ist es im Kern, dieses sagenumwobene Homeoffice? Und was macht es mit uns?
Dem japanischen Theaterstar Toshiki Okada gelingt es immer wieder, explosive Situationen auf das Unterhaltsamste und Anregendste implodieren zu lassen. Okada ist bekannt für seine eigenwillige Formsprache und die Beschäftigung mit kulturellen Umbrüchen. Zusammen mit seiner Kompanie Chelfitsch erlangte er internationale Bekanntheit und ist mit seinen Inszenierungen in Asien und Nordamerika wie auch regelmäßig in Europa zu Gast, zuletzt in München und Hamburg.
Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Ensemble wird Toshiki Okada über unsere Gegenwart nachdenken – in faszinierenden Choreografien, die sich vollständig von ihrem Sprechen ablösen. Das Innerste wird zum Äußersten, rätselhafte Rituale entstehen.
ホームオフィス
岡田利規 作
ドイツ語翻訳 アンドレアス・レーゲルスベルガー
初日/世界初演 2024年4月20日19:30
初日以外の上演日:4月17日19:00(公開稽古/プレビュー)、
4月26日19:30、5月4日19:30、5月28日19:30
デュッセルドルフ市立劇場 大劇場
ドイツ語翻訳 アンドレアス・レーゲルスベルガー
初日/世界初演 2024年4月20日19:30
初日以外の上演日:4月17日19:00(公開稽古/プレビュー)、
4月26日19:30、5月4日19:30、5月28日19:30
デュッセルドルフ市立劇場 大劇場
在宅勤務(ホームオフィス)ほど私たちの仕事の日常を大きく変えたものはないでしょう。もはや自宅と勤務先のオフィスを往復するのではなく、移動しながら、リスボンだろうとタイのビーチだろうと、どこでも好きな場所で仕事ができます。企業はオフィス賃料を節約でき、ワーク・ライフ・バランスもついに実現、のはず…。ちなみに米国では平日のゴルフ場使用率が50%増加、とのこと。
この、伝説に包まれたホームオフィス。その核心には何があるのでしょう?私たちにどのような影響をもたらすのでしょう?
岡田利規は、実は、日本演劇界のスター(註:ドイツ語原文ママ)。一触即発状況を極限的面白さへと内破させることに長け、独自の演劇言語と、変容する社会への視線の鋭さで高く評価されています。主宰するカンパニー、チェルフィッチュとともに日本国内のみならず、アジア、北米・南米、欧州に多くの作品が招かれています。近年はドイツの公立劇場(ミュンヘン、ハンブルク)で演出を手がけています。
デュッセルドルフ市立劇場のアンサンブルとともに、岡田利規は、台詞と、そこから切り離された身体言語を通して、私たちが生きる現代について考えます。最も隠蔽された内面が、最も表面へと暴露され、摩訶不思議かつ儀礼的身振りが執り行われます。
出演:ソニヤ・バイスヴェンガー、トーマス・ハウザー、ベレンジュワ・ピーター・エケンバ、ライナー・フィリッピ、キリアン・ポネルト、クラウディウス・シュテフェンス、ブランカ・ヴィンクラー/作・演出:岡田利規/舞台美術:アンスガー・プリュヴァー/衣裳:トゥツィア・シャード/音楽:内橋和久/照明:ジャン=マリオ・-ベシエール/ドラマトゥルギー:マティアス・リリエンタール、山口真樹子、ローベルト・コアル
この、伝説に包まれたホームオフィス。その核心には何があるのでしょう?私たちにどのような影響をもたらすのでしょう?
岡田利規は、実は、日本演劇界のスター(註:ドイツ語原文ママ)。一触即発状況を極限的面白さへと内破させることに長け、独自の演劇言語と、変容する社会への視線の鋭さで高く評価されています。主宰するカンパニー、チェルフィッチュとともに日本国内のみならず、アジア、北米・南米、欧州に多くの作品が招かれています。近年はドイツの公立劇場(ミュンヘン、ハンブルク)で演出を手がけています。
デュッセルドルフ市立劇場のアンサンブルとともに、岡田利規は、台詞と、そこから切り離された身体言語を通して、私たちが生きる現代について考えます。最も隠蔽された内面が、最も表面へと暴露され、摩訶不思議かつ儀礼的身振りが執り行われます。
出演:ソニヤ・バイスヴェンガー、トーマス・ハウザー、ベレンジュワ・ピーター・エケンバ、ライナー・フィリッピ、キリアン・ポネルト、クラウディウス・シュテフェンス、ブランカ・ヴィンクラー/作・演出:岡田利規/舞台美術:アンスガー・プリュヴァー/衣裳:トゥツィア・シャード/音楽:内橋和久/照明:ジャン=マリオ・-ベシエール/ドラマトゥルギー:マティアス・リリエンタール、山口真樹子、ローベルト・コアル
Besetzung
Text und Regie Toshiki Okada
Bühne Ansgar Prüwer
Kostüm Tutia Schaad
Musik Kazuhisa Uchihashi
Licht Jean-Mario Bessière
Dramaturgie Matthias Lilienthal, Makiko Yamaguchi, Robert Koall
Dauer
1 Stunde 30 Minuten — keine Pause
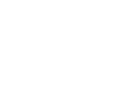
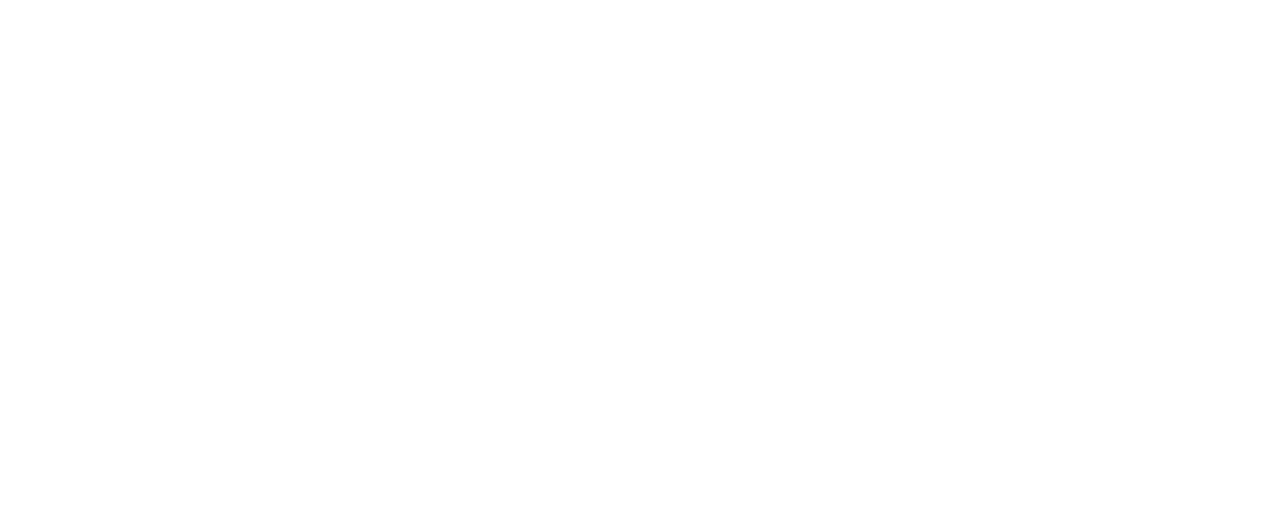


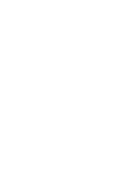
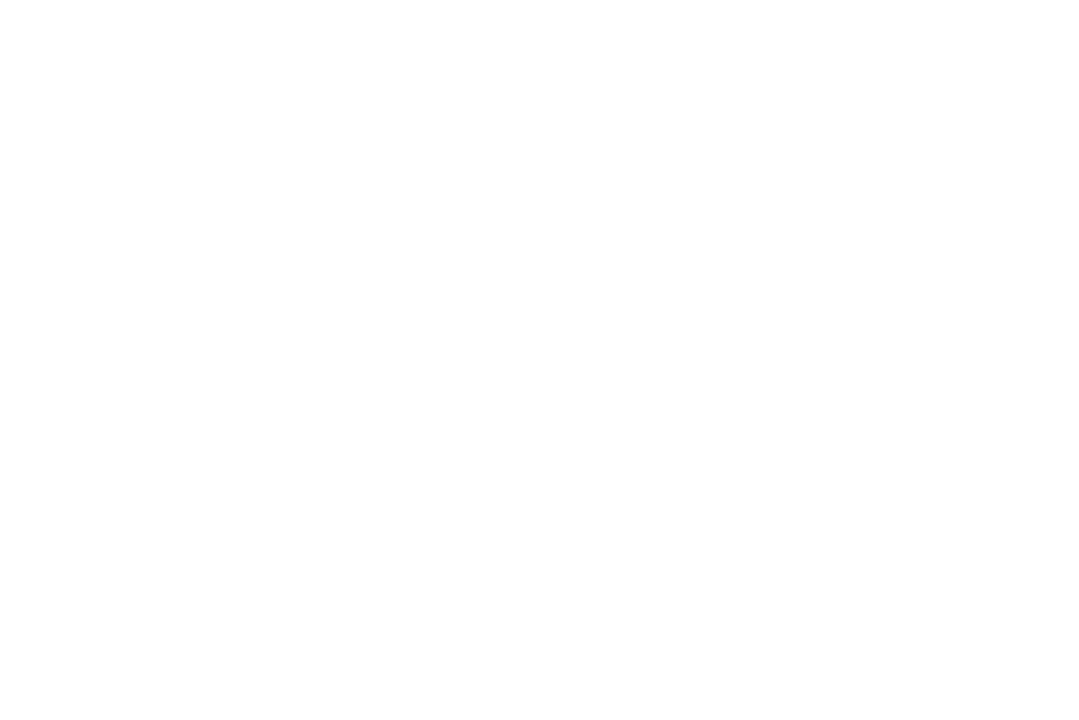
Pressestimmen