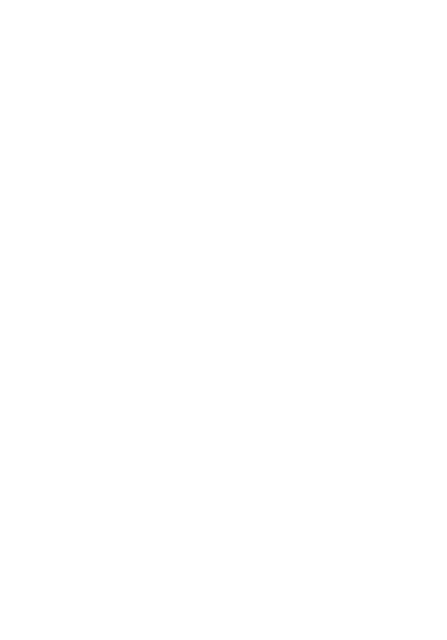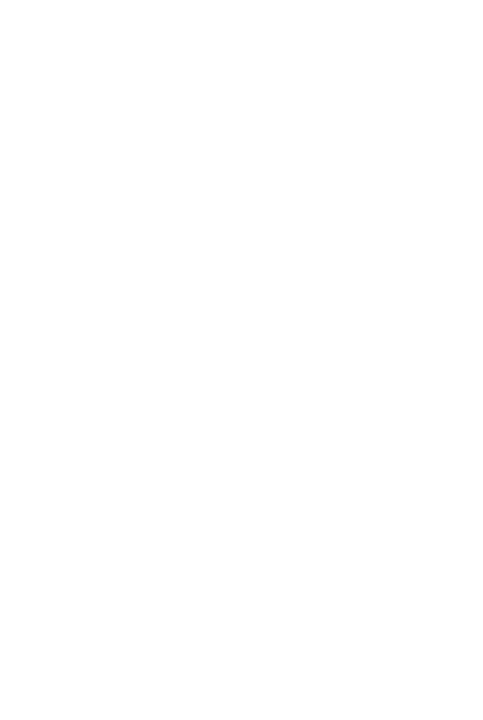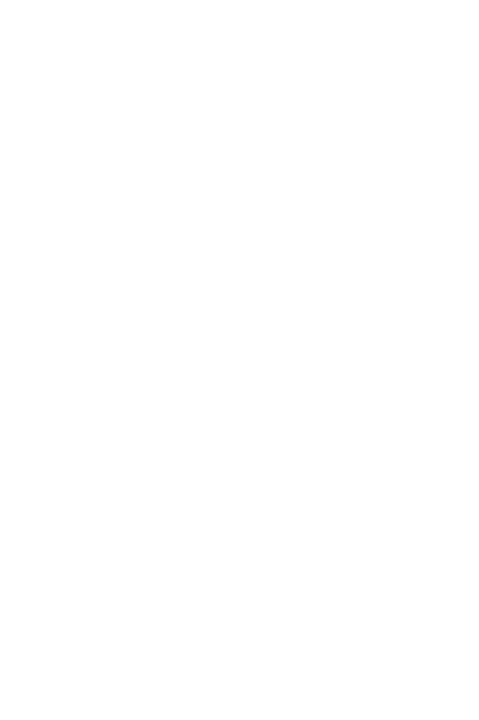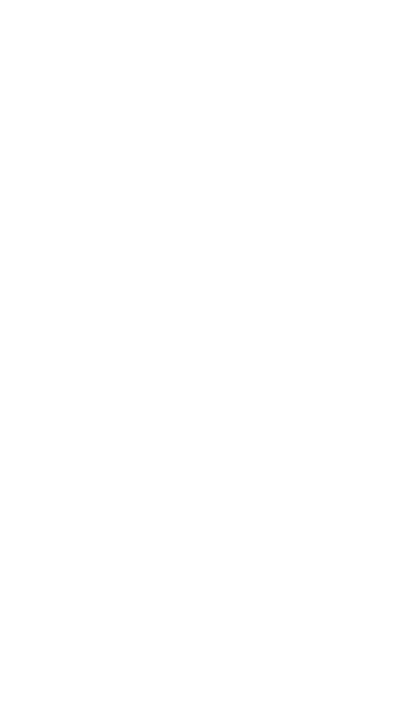Longings and Belongings
Neue Veranstaltungsreihe über Sehnsüchte und ZugehörigkeitenNächste Ausgabe: Black sounds, white ears — Eine kritische Betrachtung der Jazz-Rezeption in der Musik- und Kunstszene in Deutschland — Zu Gast: Harald Kisiedu, Anys Reimann, Hermes Villena — am 16. Mai um 20 Uhr — in Kooperation mit Callshop RadioSchauspielhaus, Kleines Haus
Termine
Fr, 16.05. / 20:00
Die Jazz-Rezeption in der Musik- und Kunstszene in Deutschland — Vortrag, Lecture-Performance und Party — Longings and Belongings 3
Schauspielhaus, Unterhaus
Mi, 02.07. / 20:00
Dokumentarfilmvorführung in Gedenken an das Massaker in Sivas/Türkei am 2. Juli 1993 mit anschließendem Gespräch — Longings and Belongings 4
Schauspielhaus, Kleines Haus
In Kooperation mit der Alevitischen Gemeinde Düsseldorf e.V.
Wir veröffentlichen regelmäßig neue Termine.
Über die Veranstaltungsreihe
Das tägliche Dasein in unserer postmigrantischen Gesellschaft ist geprägt von Sehnsüchten und Fragen nach Zugehörigkeiten. Wer wird gehört, was wird gesehen, wessen Geschichten werden erzählt? In unserer neuen Veranstaltungsreihe »Longings and Belongings – Über Sehnsüchte und Zugehörigkeiten« wollen wir plurale, vielschichtige und intersektionale Realitäten hören, sehen, besprechen und erfahrbar machen.
Im März starten wir mit einer Lesung und einem Gespräch mit der Bestsellerautorin Alice Hasters und ihrem Buch »Identitätskrise«.
»Sind die 90er wieder zurück?«, fragen wir uns bei einem Podiumsgespräch im April und diskutieren aus den Perspektiven von Aktivismus und Journalismus. In dieser Ausgabe zeigen wir zudem Ausschnitte aus der mit dem Deutschen Theaterpreis »Der Faust« ausgezeichneten theatralen Busreise »Solingen 1993«.
Im Mai wird es um die Geschichte des Jazz und dessen heutige Rezeption in der Musik- und Kunstszene in Europa und Deutschland gehen. Wie hat sich der Jazz, der in der afroamerikanischen Kultur verwurzelt ist, entwickelt? Hat er das Potenzial, die Kluft zwischen der sogenannten Hoch- und der Subkultur zu überbrücken? Ist die Szene exklusiv oder bietet sie immer noch Räume für Experimente?
Und was haben diese ganzen Fragen mit unserer Gesellschaft und der Kunstszene zu tun? Kuratiert wird die neue Reihe von Dîlan Kılıç, Referentin für Diversität am D’haus.
Im März starten wir mit einer Lesung und einem Gespräch mit der Bestsellerautorin Alice Hasters und ihrem Buch »Identitätskrise«.
»Sind die 90er wieder zurück?«, fragen wir uns bei einem Podiumsgespräch im April und diskutieren aus den Perspektiven von Aktivismus und Journalismus. In dieser Ausgabe zeigen wir zudem Ausschnitte aus der mit dem Deutschen Theaterpreis »Der Faust« ausgezeichneten theatralen Busreise »Solingen 1993«.
Im Mai wird es um die Geschichte des Jazz und dessen heutige Rezeption in der Musik- und Kunstszene in Europa und Deutschland gehen. Wie hat sich der Jazz, der in der afroamerikanischen Kultur verwurzelt ist, entwickelt? Hat er das Potenzial, die Kluft zwischen der sogenannten Hoch- und der Subkultur zu überbrücken? Ist die Szene exklusiv oder bietet sie immer noch Räume für Experimente?
Und was haben diese ganzen Fragen mit unserer Gesellschaft und der Kunstszene zu tun? Kuratiert wird die neue Reihe von Dîlan Kılıç, Referentin für Diversität am D’haus.
Kommende Ausgaben
Black sounds, white ears
Eine kritische Betrachtung der Jazz-Rezeption in der Musik- und Kunstszene in Deutschland — Zu Gast: Harald Kisiedu, Anys Reimann, Hermes Villena — am 16. Mai um 20 Uhr
Unutulmayan (Evergreen)
Dokumentarfilmvorführung in Gedenken an das Massaker in Sivas/Türkei am 2. Juli 1993 mit anschließendem Gespräch — OmU, 2024, 50 min., Regie: Eylem Şen — am 2. Juli um 20 Uhr — Schauspielhaus, Kleines Haus — In Kooperation mit der Alevitischen Gemeinde Düsseldorf e.V.
Vergangene Ausgaben
Alice Hasters liest aus »Identitätskrise«
Lesung und Gespräch — am 23. März um 18 Uhr
Sind die 90er zurück?
Zu Gast: Kutlu Yurtseven, Gamze Kubaşık, Ali Şirin und das Ensemble der Stadt:Kollektiv-Produktion »Solingen 1993« — am 30. April um 20 Uhr